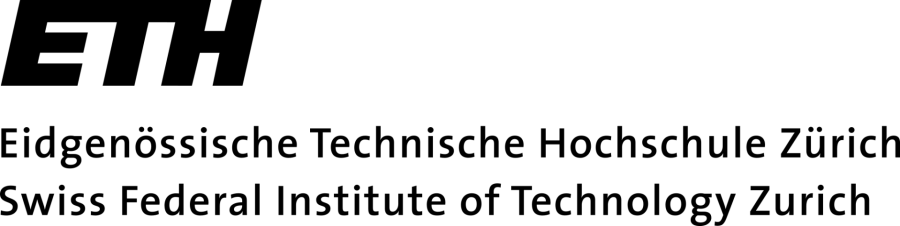Zwei erneuerbare Energien sollen bei der Energiestrategie 2050 eine entscheidende Rolle spielen: Die Wasserkraft und die tiefe Geothermie, wo heisses Wasser aus dem Untergrund als Energiequelle dient. In einem Verbundprojekt haben sich Forschende deshalb intensiv mit den beiden Methoden der Stromgewinnung auseinandergesetzt, deren Voraussetzungen unterschiedlicher kaum sein könnten.
Die Wasserkraft steuert heute 60 Prozent zum Schweizer Strommix bei. Die Ausbaumöglichkeiten sind beschränkt, weshalb sich die Forschung auf die Optimierung und Weiterentwicklung der bestehenden Kraftwerke konzentriert. Das Ziel wäre eine Produktionssteigerung von 10 Prozent.
Ganz anders sieht es bei der tiefen Geothermie aus: Zwar sollte auch sie bald eine wichtige Rolle übernehmen, doch zurzeit wird in der Schweiz kein Strom mit dieser Methode gewonnen. Deshalb gingen die Forscher der Frage nach, ob Erdwärme überhaupt einen bedeutenden Teil der nationalen Energiegewinnung beisteuern kann – und wie das auf eine sichere Art und Weise genutzt werden kann.